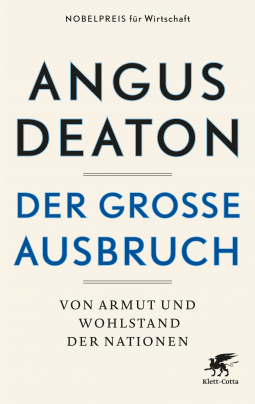
Der große Ausbruch
Von Armut und Wohlstand der Nationen
von Angus Deaton
Dieser Titel war ehemals bei NetGalley verfügbar und ist jetzt archiviert.
Bestellen oder kaufen Sie dieses Buch in der Verkaufsstelle Ihrer Wahl. Buchhandlung finden.
NetGalley-Bücher direkt an an Kindle oder die Kindle-App senden.
1
Um auf Ihrem Kindle oder in der Kindle-App zu lesen fügen Sie kindle@netgalley.com als bestätigte E-Mail-Adresse in Ihrem Amazon-Account hinzu. Klicken Sie hier für eine ausführliche Erklärung.
2
Geben Sie außerdem hier Ihre Kindle-E-Mail-Adresse ein. Sie finden diese in Ihrem Amazon-Account.
Erscheinungstermin 14.01.2017 | Archivierungsdatum 20.04.2017
Zum Inhalt
Heute sind die Menschen gesünder, wohlhabender und sie leben länger als früher. Einem Teil der Menschheit ist »Der Große Ausbruch« aus Armut, Not, Krankheit und Entbehrung in Freiheit, Bildung...
Verfügbare Ausgaben
| AUSGABE | E-Book |
| ISBN | 9783608100747 |
| PREIS | 14,99 € (EUR) |
| SEITEN | 448 |
Rezensionen der NetGalley-Mitglieder
In „Der große Ausbruch. Von Armut und Wohlstand der Nationen“ setzt sich Deaton mit Zusammenhängen zwischen Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit, Wohlstand des Einzelnen und des Staates auseinander. Die weit klaffende Schere zwischen Arm und Reich in Nationalstaaten und das Wohlstandsgefälle zwischen armen und reichen Ländern sind ein höchst aktuelles Thema angesichts der globalen Armutsemigration. Deaton ist ein erklärter Gegner von Entwicklungshilfe (insbesondere der Weltbank) und Kritiker einer allgemeinen Krankenversicherung in den USA.
Vom Armutsforscher Amartya Sen hat Deaton sich anregen lassen, „Wohlstand“ ganzheitlich zu betrachten als Zusammenwirken von Lebenserwartung, Gesundheit, Freiheit und subjektiver Zufriedenheit. Die Schwäche von Statistik sieht der Verfasser beim Thema Armut und Wohlstand darin, dass deren Teilaspekte nur einzeln untersucht würden und allein durch den Sprachgebrauch unterschiedlicher Länder Unschärfen entstehen. Die Geschichte des Fortschritts war stets eine Geschichte der Ungleichheit, der Kluft zwischen jenen, die von Veränderungen profitierten und den von der Entwicklung Abgehängten. In diesem Zusammenhang bringt der Autor das treffende Bild von Gewinnern ein, die die Leitern hochziehen. Nachfolgende sollen von einer Entwicklung nicht mehr profitieren können, z. B. indem der Zugang zum Bildungs- und Gesundheitswesen eingeschränkt wird. Ein Schelm, wer darin ein Abbild der USA im Jahr 2017 erkennen wollte. In den USA klaffen heute die Haushaltseinkommen der reichsten 5% der befragten Einwohner und der ärmsten 20% der Befragten Jahr für Jahr weiter auseinander.
Eine hohe Lebenserwartung korreliert nach Deaton nicht mit Zufriedenheit und Wirtschaftswachstum konnte bisher Armut nicht verhindern. Aus Statistiken und in historischen Rückblicken extrahiert Deaton Problemfelder, die die USA und die Weltgemeinschaft dringend in Angriff nehmen müssten. Dazu gehören die für einen rein rechnerisch wohlhabenden Staat ungewöhnlich niedrige Lebenserwartung in den USA, sowie die Schere zwischen erfolgreichen Industriestaaten und Staaten, die ihrer wachsenden Bevölkerung keine menschenwürdigen Arbeitsplätze bieten können. Den direkten Zusammenhang zwischen Teilhabe von Frauen in allen Lebensbereichen und Überlebenschancen ihrer Kinder kennt Deaton, hätte ihn jedoch pointierter formulieren können. Nicht nur für die Organisation einer funktionierenden Infrastruktur wird ein starker Staat mit gut organisierter Verwaltung benötigt, sondern auch für die Umsetzung fortschrittlicher Einstellungen, die Frauen nicht vom Bildungs- und Gesundheitssystem ausschließen. Wenn das Einkommensniveau eines Landes nicht Grund von Kindersterblichkeit ist, warum sterben dann so viele Kinder in armen Ländern? Und welchen Einfluss haben reiche Staaten auf Entwicklungen in armen Ländern, fragt Deaton.
Deaton ist erklärter Gegner von Entwicklungshilfe, die seiner Ansicht nach nicht entwickelt, sondern schadet. Seine Kritkpunkte: das Helfersyndrom der Geberländer, instinktloses Auftreten der NGOs in Empfängerländern, mangelnde Kontrolle der Wirksamkeit, Ungerechtigkeit, dass kleine Länder pro Kopf mehr Mittel erhalten als große, bevölkerungsreiche Länder, Unterstützung korrupter Regimes, Mittelvergabe nach Eigeninteressen der Geberländer und Lieferung von Waffen in Krisengebiete. Er kann die Zusammenhänge sehr eindrucksvoll erklären, kritisiert die Verhältnisse engagiert und führt vielfältige Quellen zum Thema an. Das Entwicklungshilfe-Kapitel fällt gegenüber der Historie und der Grundlagendarstellung vergleichsweise knapp aus.
Ein zu euphorischer Klappentext kündigt hier ein populäres Sachbuch an (2013 im Original erschienen), das für Leser in Europa bedingt interessant ist. Für mich war etwas enttäuschend, dass das Buch Dambisa Moyo: "Dead Aid. Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert und was Afrika besser machen kann" (engl. 2009) diese Zusammenhänge bereits umfassend dargestellt hat und sich in den vier Jahren bis zu Deatons Buch offenbar keine neuen Erkenntnisse ergaben. Deatons Zahlenmaterial stammt aus dem Zeitraum bis 2010 und ist damit schon recht alt. . Deaton neigt zu Weitschweifigkeit und Wiederholungen, bis er auf den Punkt kommt. Die Einzelaspekte der drei großen Kapitel sind zwar für sich interessant, insgesamt fehlt mir im Buch ein roter Faden, der Alles mit Allem zusammenhält.
Zusätzlich zum US-amerikanischen Tunnelblick, der keine Veränderung amerikanischer Verhältnisse zulassen will, zeigt Angus Deaton kaum Fantasie für Entwicklungen in der Zukunft. Probleme des Niedriglohnsektors in den USA verharmlost er, da eine reiche Bevölkerungsschicht doch Arbeitsplätze für Hauspersonal schaffen würde. Wie sich der amerikanische Arbeitsmarkt entwickeln wird, scheint er sich noch nicht vorstellen zu können, wenn durch den Fortschritt in der IT-Technik automatisierte Verfahren und künstliche Intelligenz ganze Berufsfelder im Bereich einfacher Büroarbeiten ersetzen werden. Aussagen eines Ökonomen wie „Amerikaner sind insgesamt reicher als Europäer und können sich diese Dinge (ein kostspieliges Gesundheitssystem) leisten“, hätte ich gern empirisch belegt gesehen. Wer als Leser generell bereit ist, sich mit der Erkennung von Mustern und mit Feinheiten der Statistik auseinanderzusetzen, wird hier jedenfalls lernen, Schlagzeilen und absoluten Behauptungen besser zu misstrauen.
Empfehlen kann ich das Buch Lesern, die Dambisa Moyos Buch noch nicht kennen und die die auf den Status Quo in den USA beharrende Haltung Deatons tolerieren können.



